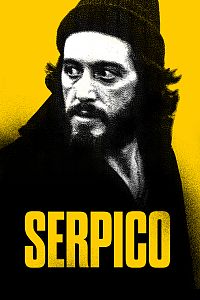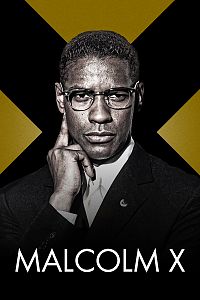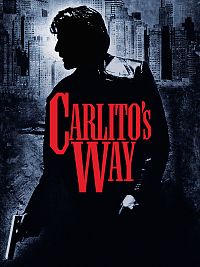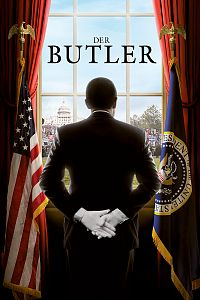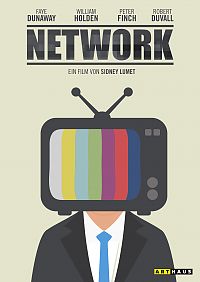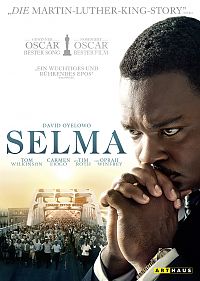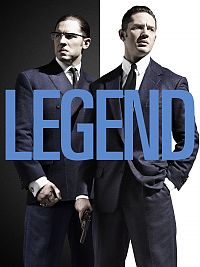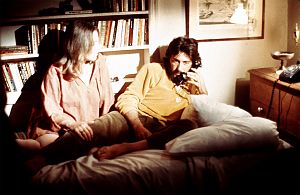Zum 100. von Malcolm X – die Entstehung des epochalen Biopics von Spike Lee
Am 19. Mai wäre der 1965 ermordete Aktivist, Prediger und Bürgerrechtler Malcolm X 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass wird Spike Lees Dreieinhalb-Stunden-Biopic Malcolm X in Ultra 4K wiederveröffentlicht. Ein Blick auf die Entstehung dieses faszinierenden Films, der 1993 einen popkulturellen Hype um X auslöste.
Wer sich heute noch einmal Spike Lees Malcolm X anschaut, tut das oft mit dem Wissen, eine Art zertifiziertes "Meisterwerk" zu schauen. Oder ein "Opus Magnum". Oder, wie wir in dieser Headline schrieben, ein "epochales Biopic". Die großen Worte sind in diesem Fall durchaus angebracht, nehmen der Rezeption aber die Wucht, die dieser Film hatte, als er 1993 in die Kinos kam.
Malcolm X mag heute eine Art politischer Popstar sein, der ähnlich wie Che Guevara zahlreiche T-Shirts, Poster, Kunstdrucke und Protestplakate ziert – aber das war Anfang der 90er noch nicht so. Das weiße Amerika, das auch Hollywood regierte, hasste den Bürgerrechtler, Prediger und Aktivisten lange Zeit für seine unerbittliche und natürlich historisch völlig berechtigte Wut. Eine millionenschwere Filmproduktion von Warner Bros., die Malcolm Xs Leben mit all seinen Widersprüchen und radikalen Phasen erzählt, war lange Zeit schlichtweg undenkbar.
Dass sich das geändert hatte, erklärte Spike Lee 1993 in einem Interview mit der "Los Angeles Times" mit bissigen Worten so: "Malcolm X ist heute für das weiße Amerika viel weniger bedrohlich, weil er seit 30 Jahren tot ist. Aber damals gab es eine ganze Menge Schwarzer, die Malcolm X ebenfalls für verrückt hielten. Es gibt immer noch Onkel Toms, N**** mit Kopftüchern wie Carl Rowan, die Kolumnen schreiben, in denen sie behaupten, Malcolm X sei als Held für die Jugend von heute ungeeignet."
Spike Lee: "Es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir nicht tun würden, wenn wir auf Malcolm X hören würden."
Für viele, vor allem junge Schwarze Menschen war Malcolm X aber genau dieser Held – eben, weil er einen Kampf für Gleichheit propagierte, der "alle nötigen Mittel" rechtfertigte. Spike Lee betonte außerdem immer wieder, dass man damals in der Schule kaum etwas über diesen Teil der Bürgerrechtsbewegung lernte. Deshalb riet er den Kids, man solle gemeinsam die Schule schwänzen, um Malcolm X im Kino zu schauen. Vor allem junge Schwarze amerikanische Männer könnten viel von X lernen, meinte Lee: "Wenn junge schwarze Männer ihm zuhören, wenn sie das Buch gelesen und den Film gesehen haben, werden sie erkennen, wie sehr Malcolm X Wert auf Bildung gelegt hat. Wenn junge schwarze Männer wirklich auf das hören würden, was Malcolm X gesagt hat, würden wir uns nicht in dieser Zahl gegenseitig umbringen. Wir würden nicht mit Drogen zu tun haben. Wir würden nicht so viele unserer Schwestern schwängern. Es gibt eine ganze Menge Dinge, die wir nicht tun würden, wenn wir auf Malcolm X hören würden."
Ein langwieriger Start
Spike Lee musste hart dafür kämpfen, dass sein Film so episch werden konnte. Die Finanzierung war knapp kalkuliert und kaum für ein Drei-Stunden-Werk ausgelegt. Die Rechte an einer Verfilmung nach dem Buch "The Autobiography of Malcolm X", das X – der eigentlich Malcolm Little hieß – mit dem Journalisten Alex Haley geschrieben hatte, lagen schon seit 1967 bei Produzent Marvin Worth. Der hatte Malcolm X einst noch persönlich getroffen – zur der Zeit, als sich dieser noch "Detroit Red" nannte und in New Yorker Jazz-Clubs Drogen vertickte. Im Laufe der Jahre waren viele schillernde Namen in das Projekt involviert. Richard Pryor, Eddie Murphy, Regisseur Sidney Lumet, sogar Autor James Baldwin, der mit Arnold Perl ein Drehbuch schrieb. Es war dann auch dieses Script, mit dem Lee seine Arbeit aufnahm – allerdings ließ er es in einem Maße umschreiben, dass die Baldwin-Familie am Ende James Baldwins Namen nicht mehr in den Credits haben wollte.
Für Spike Lee war dieser Film seit College-Zeit ein Traumprojekt. Warner Bros. wollte eigentlich den weißen, kanadischen Regisseur Norman Jewison für das Projekt, aber als das für Entrüstung in der Schwarzen Community sorgte, kam Lees große Chance. Er reizte das Budget voll aus, sparte am eigenen Salär und drohte auf halber Strecke gar zu scheitern. Spike Lee rettete das Projekt, in dem er namhafte und finanzstarke Afro-Amerikaner darum bat, das Projekt mit einer Spende zu unterstützen. So ist es am Ende also auch Bill Cosby, Oprah Winfrey, Tracey Chapman, Janet Jackson und Prince zu verdanken, dass der Film Malcolm X heute so episch wirken kann.
Spike Lee: "Malcolm X so viele verschiedene Menschen."
Spike Lee zeigt in Malcolm X dessen prägenden Lebensphasen und gibt jedem Kapitel eine eigene Ästhetik. Wann immer es möglich war, drehte er an Originalschauplätzen – selbst für Mekka bekam er eine Genehmigung. Die Kindheit des Malcolm Little wird lediglich in kurzen Rückblenden erzählt. Spike Lee konzentriert sich zuerst auf die Zeit von Malcolm Little als Kleinganove und Womanizer vor allem weißer Frauen. Dann folgt ein dunkles Knastdrama, in dem Malcolm X seinen Namen und Erleuchtung bei einem Prediger der Nation of Islam findet. Wir sehen, wie er nach seiner Entlassung hartnäckig und charismatisch zum beliebten Prediger wird, müssen aber auch die Audienzen beim religiösen Führer Elijah Muhammad ertragen, der Antisemitismus und Frauenfeindlichkeit predigt. Wir sehen die heute historischen Auseinandersetzungen und Reden, den privaten Frieden in Malcolms Ehe mit Betty Shabazz, seine Pilgerreise gen Mekka, den Bruch mit der Nation of Islam, und die brutale Ermordung am 21. Februar 1965 in New York, wo er bei einer öffentlichen Veranstaltung von seinen ehemaligen Glaubensbrüdern erschossen wurde.
Spike Lee meint: "Malcolm X so viele verschiedene Menschen. Er hat sich ständig weiterentwickelt. Die Menschen werden sich aussuchen, welcher Malcolm mehr mit ihren eigenen Gefühlen, ihren eigenen politischen Gedanken übereinstimmt."
Denzel Washingtons "Oscar Snub"
Denzel Washington spielt diesen Malcolm X ebenso vielseitig wie dessen Leben war. Er gleitet wie eine grinsende Raubkatze durch das Detroit und das New York der unsteten Jahre von Malcolm Little, leidet stoisch im Gefängnis, strahlt eine erhabene Coolness und kontrollierte Wut aus, als er Prediger und immer mehr Aktivist wird. Am Ende spielt Denzel Washington einen Mann, der in seiner Familie und in einer gemäßigten Version seines Glaubens eine innere Ruhe gefunden zu haben scheint.
In einer der intensivsten Szenen des Films sieht man nur Denzel Washington als Malcolm X, wie er im Auto sitzt und zu der Veranstaltung fährt, auf der er sterben wird. Dazu läuft Sam Cookes brillanter Song "A Change Is Gonna Come". Einer der ersten explizit politischen Songs des Sängers, den Cooke angeblich schrieb, nachdem er Malcolm X, Cassius Clay und NFL-Spieler Jim Brown in Miami getroffen hatte. Der – ebenfalls faszinierende – Film One Night In Miami erzählt fiktionalisiert von dieser Begegnung und legt die These nahe, X hätte Cooke überzeugt, auch eine politische Stimme zu werden.
Denzel Washington wurde zwar für einen Oscar nominiert – verlor aber gegen Al Pacino für Der Duft der Frauen. Einer der berühmtesten "Oscar Snubs" der Filmgeschichte. Das sieht auch Spike Lee noch immer so. Bei einem aktuellen Videointerview mit dem Magazin "Newsweek" sagt Lee dazu grinsend: "We all know … we know… we know …"
Spike Lee: "Betrachten Sie diesen Film nicht nur als Fossil, als Dinosaurier, als historisches Dokument."
Spike Lee war es aber vor allem wichtig, Malcolm X und seine Lehren in die Jetztzeit zu holen. Das zeigt schon die damals brandaktuelle Eröffnungsszene: Wir sehen dort Originalaufnahmen – aber nicht etwa eine legendäre Malcolm-X-Rede aus den 60ern, sondern die brutale Misshandlung des Afroamerikaners Rodney King am 3. März 1991. Videoaufnahmen dieser Szene, die zeigen, wie King von einer Gruppe Polizisten halb tot geprügelt wird, und der Freispruch der Beamten ein Jahr später, lösten die Unruhen in Los Angeles aus, die 1992 als "LA Riots" in die Geschichte eingingen. Am Ende von Malcolm X zeigt Lee wiederum Aufnahmen von Nelson Mandela, der in einer Rede in Südafrika Malcolm X zitiert.
Spike Lee sagte der "Los Angeles Times" 1993 dazu: "Was Malcolm X damals, vor 30 Jahren, gesagt hat, ist auch heute noch aktuell. Schwarze Menschen sind in diesem Land noch Bürger zweiter Klasse. Deshalb haben wir den Film mit der Verbrennung der amerikanischen Flagge zu einem X und den Aufnahmen von Rodney King begonnen, um zu zeigen, dass es nicht viel Fortschritt gegeben hat. Und bitte betrachten Sie diesen Film nicht nur als Fossil, als Dinosaurier, als historisches Dokument. Das, worüber Malcolm X gesprochen hat, ist auch heute noch relevant. Und das beste Beispiel dafür ist dieses Videoband, das die ganze Welt gesehen hat. Die ganze Welt hat es gesehen. Und dennoch wurde keine Gerechtigkeit walten lassen."
Sätze, die leider heute – im Angesicht des unverhohlenen Rassismus der aktuellen Trump-Regierung – in großen Teilen noch immer gültig sind.
Daniel Koch