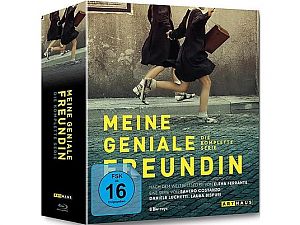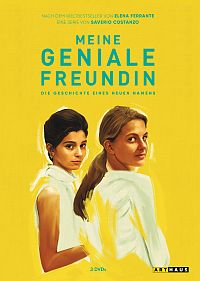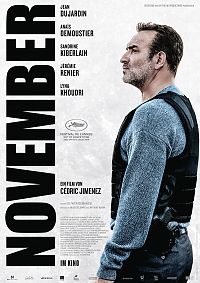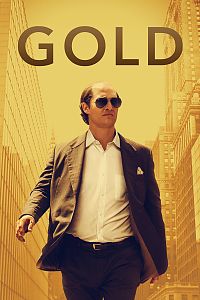Meine geniale Freundin und das Ferrante-Fieber
Ab sofort gibt es alle vier Staffeln der Serie Meine geniale Freundin nach Elena Ferrantes "Neapolitanischer Saga" in einer Box bei ARTHAUS. Eine gute Gelegenheit, um noch einmal von den ersten Diagnosen des Ferrante-Fiebers zu erzählen – und von dem Weg vom ersten Roman, zum Hype, zur Saga, zum Literatur-Mysterium und zu dieser tollen Serie.
Elena Ferrante ist bis heute ein Mysterium. Und natürlich das 1992 zum ersten Mal genutzte Pseudonym einer der erfolgreichsten Schrifsteller*innen der letzten Jahre. Was vor allem an ihrer "Neapolitanischen Saga" liegt, die mit dem Roman Meine geniale Freundin ihren Anfang nahm, der auch der gerade beendeten Serie seinen Titel gab. Wobei Ferrante darauf besteht, dass diese Bücher keine "Saga" ergäben, sondern ein Roman in vier Teilen sei. Der wirtschaftliche Erfolg, der in diesem recht seltenen Fall auch mit hymnischen Kritiken einhergeht, ist bis heute immens: Die Bände wurden mittlerweile über fünf Millionen Mal verkauft und in 40 Sprachen übersetzt. Seit der Übersetzung ins Englische und Deutsche spricht man gar vom "Ferrante-Fieber", das ihre Leserschaft ergriffen hat.
Begonnen hatte der internationale Hype mit einem Portrait im renommierten Kulturmagazin "New Yorker" im Jahr 2013, zwei Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Bandes im italienischen Original. Ferrante gewährte dem Magazin eines ihrer seltenen Mailinterviews (mit der Bitte, es kurz zu halten) – eine naheliegende Wahl, denn die "New Yorker"-Redakteurin Ann Goldstein ist auch die englische Übersetzerin von Ferrantes Werk. Den Text schrieb dann jedoch Kulturjournalist James Wood. "Women on the verge – The fiction of Elena Ferrante" ist eine Mischung aus Portrait, Interview und Literaturkritik – wobei das Wort "Kritik" ein wenig in die irre führt. Man merkt recht schnell, dass Wood bereits mit dem Ferrante-Fieber infiziert war, auch wenn diese Diagnose damals noch nicht so verbreitet war.
Über ihre Entscheidung im Geheimen zu bleiben, erklärte Elena Ferrante damals: "Ich glaube, dass Bücher, sobald sie geschrieben sind, ihre Autoren nicht mehr brauchen. Wenn sie etwas zu sagen haben, finden sie früher oder später ihre Leser*innen. Wenn nicht, dann eben nicht. ... Ich liebe diese geheimnisvollen Bände, sowohl alte als auch moderne, die keinen bestimmten Autor haben, aber ein intensives Eigenleben hatten und weiterhin haben. Sie erscheinen mir wie eine Art nächtliches Wunder, wie die Geschenke der Befana [die italienische Weihnachtshexe, Anm. der Red.], auf die ich als Kind gewartet habe. ... Wahre Wunder sind diejenigen, deren Schöpfer niemals bekannt werden. ... Außerdem, ist es nicht so, dass Werbung teuer ist? Ich werde der günstigste Autor des Verlags sein. Ich erspare Ihnen sogar meine Anwesenheit."
Dieser Artikel und der Mantel des Unwissens waren natürlich die beste Werbung, die man sich als Verlag wünschen kann – was allerdings nur so gut funktionierte, weil es sich bei Ferrantes Romanen wirklich um brillante Literatur handelt. Bis heute rätselt man über Ferrantes Identität, auch wenn der italienische Journalist Claudio Gatti 2016 enthüllt haben will, dass es sich bei ihr um Anita Raja handelt – eine in Neapel geborene, in Rom lebende Übersetzerin, die u. a. Romane von Franz Kafka, Bertolt Brecht, Christa Wolf und Ilse Aichinger vom Deutschen ins Englische übersetzt hat. Die Ferrante-Fans hassten Gatti dafür – und scherten sich nicht lange rum, ihm zu glauben. Raja ist übrigens mit dem Autor Domenico Starnone verheiratet – und natürlich dauerte es nicht lange, bis die ersten Journalisten (hier müssen wir nicht gendern) laut spekulierten, er habe ganz bestimmt diese erstaunlichen Romane über das komplexe Leben zweier Frauen geschrieben.
Die erste Folge der ersten Staffel der Serie Meine geniale Freundin wurde dann im November 2018 auf HBO ausgestrahlt. Die Regie übernahm – was die Ferrante-Fans erst erzürnte – der Regisseur Saverio Costanzo. Das führte natürlich zur Frage, die schon das Spekulieren um Domenico Starnone aufwarf: Kann sich ein Mann in diese Freundschaft, diese Geschichte, diese Leben hineindenken? Einige Kritikerinnen verneinten das. Julie Kosin vom renommierten Harper's Bazaar zum Beispiel. Sie schrieb: "Als Mann ist es unmöglich, sich mit Lilas und Lenùs Kämpfen zu identifizieren." Jennifer Schuur wiederum, ausführende Produzentin bei HBO, zeigte sich anfangs "überrascht" von der Wahl Ferrantes. "Auf den ersten Blick würde man nicht denken, dass ein Mann all die Nuancen von Ferrantes Geschichte verstehen würde." Sie habe jedoch gewusst, dass Costanzo sehr vorsichtig mit dem Geschenk umgehen würde, dass man ihm durch diesen Job gegeben hatte. Das war dann auch wohl der Grund, warum die Ferrante-Fieber-Infizierten der Serie eine Chance gaben: Ferrante hatte sich Saverio Costanzo selbst als Regisseur gewünscht.
Die Geschichte von Saverio Costanzo – dessen Film Hungry Hearts mit Adam Driver wir an dieser Stelle wärmstens empfehlen möchten – und Elena Ferrante begann gut zehn Jahre vor dieser Zusammenarbeit für Meine geniale Freundin. Schon 2007 kontaktierte Costanzo die Herausgeber Ferrantes, weil er die 2006 erschienene Novelle "Die Frau im Dunkeln" von ihr verfilmen wollte. Zur Überraschung aller erlaubte Ferrante ihm, innerhalb von sechs Monaten eine Filmadaption zu konzipieren. Costanzo scheiterte an "diesem sehr dünnen, sehr präzisen, sehr gefährlichen Buch" und gestand ihr seine Niederlage. Er gab die Rechte wieder zurück. "Ich war noch ein Anfänger", sagte Costanzo der New York Times dazu. Bis 2016 hörte er nichts von ihr, bis ihr italienischer Verlag anrief und ihm mitteilte, er sei einer von wenigen Regisseuren, die Ferrante für die TV-Verfilmung vorgeschlagen hatte. Wenige Wochen später kam das konkrete Angebot. Costanzo zögerte erst. Er hatte tiefen Respekt vor der einzigartigen Schreibkunst Ferrantes und vor ihren zahlreichen, oft weiblichen Fans, die überaus kritisch auf seine Arbeit schauen würden. Und obwohl Costanzo bewiesen hatte, dass er starke weibliche Hauptrollen erschaffen konnte, würde auch die Wahl eines Mannes für Unmut sorgen. Trotzdem wusste er: Dieses Angebot konnte er nicht ausschlagen.
Zum Start der ersten Staffel erzählte Saverio Costanzo dem Magazin der "New York Times": "Ich versuche noch immer die Frage zu beantworten: 'Warum ich?' Aber das kann ich nicht – weil ich nicht Elena Ferrante bin. Ich habe sie nicht gefragt, weil ich Angst hatte, ihr zu nahe zu kommen." Ferrante kommunizierte schreibend mit ihm, kommentierte immer wieder Drehbuchteile und Dialoge, die sie missglückt oder auch gelungen fand – und legte sich dabei auch schon mal mit den Produzenten an, wenn es um Budget-Fragen ging. "Sie ist sehr stark – ich mag das", sagt Costanzo damals.
Saverio Costanzo stellte aber schon in seinem ersten offiziellen Statement zur Serie klar, wie er die Sache sieht: "Wir alle können uns mit Lila und Elena und ihrem Wunsch sich zu emanzipieren identifizieren." Er sehe den Fokus von Ferrantes Roman auch nicht zwangsläufig nur auf feministischen Themen. "Es geht nicht nur darum. Was ich an Ferrante mag ist, dass sie immer gefährlich bleibt. Vielleicht sind die Hauptcharaktere weiblich, weil sie eine Frau ist, aber für mich liegt der Fokus von Meine geniale Freundin auf Bildung. Emanzipation bedeutet bei ihnen, auf dem Fundament einer gefestigten weiblichen Seele mit Hilfe von Bildung ein noch stärkeres Bewusstsein zu erlangen. Aber es gibt auch männliche Charaktere in der Geschichte, die sich auf die gleiche Weise befreien können."
Wie so oft im Umgang mit Elena Ferrante neigt man schnell zu Kaffeesatzleserei oder zur Westentaschenpsychologie – aber man könnte durchaus vermuten, dass sie Costanzos Hadern mit ihrer Novelle damals schätzte. Oder vielmehr: sein Eingeständnis, keinen Zugang zu finden. Denn sie selbst schrieb in ihrer Kolumne für den britischen Guardian über die Verfilmung: "Ich wollte oft sagen: 'Lasst es bleiben!'" Ihre Erklärung dazu ist faszinierend ehrlich: "Mein erster Eindruck bei einer Verfilmung ist immer traumatisch. Die Drehbuchschreiberinnen und -schreiber reißen meinem Buch den literarischen Schutzmantel vom Leib. Ein schrecklicher Moment: Ich habe Jahre an diesem Text gearbeitet und jetzt wird alles plötzlich auf das Wesentliche eingedampft. […] Ein Geschehnis, das ich seitenweise beschrieben haben, wird zu einer bloßen Handlungsanweisung. […] So reduziert wirkt der Roman plötzlich wie ein billiger literarischer Zaubertrick. Die Schreibende ist beschämt und fühlt sich wie eine Hochstaplerin, weil ihre Geschichte im Kern banal ist." Aber Ferrante beschreibt in ihrer Kolumne auch die Erkenntnis, die jeder Literaturverfilmung zugrunde liegt: Das Buch wird sich immer selbst genügen, wird immer ihr Buch bleiben, wird immer die für sie bestmögliche Erzählung einer Geschichte sein, die sie erzählen wollte – und jede Serie, jeder Film kann nur eine mögliche Interpretation dieser Geschichte sein.
Vor einigen Monaten ging nun die letzte Staffel dieser Interpretation zu Ende und schaffte es, die Ferrante-Fans noch einmal zu überraschen. Zwar war deren Meinung der schon nach Ende der dritten Staffel positiv – was unserer Meinung nach auch an dem fantastischen Casting für Elena Greco (Lenù) und Raffaella Cerullo (Lila) in ihren verschiedenen Lebensphasen lag –, aber das Produzententeam, Ferrante und Saverio Costanzo hatten noch eine Neuigkeit in petto: Für die finale Staffel der Serie, die dem Roman "Die Geschichte des verlorenen Kindes" entspricht, hatte nämlich nun wiederum Saverio Costanzo eine Wunschregisseurin gesucht und gefunden. Laura Bispuri führt in allen zehn Folgen Regie und zeigt sich schon früh als perfekte Wahl. In einem Interview mit dem Magazin "Elle" sagte die Italienerin: "Saverio rief mich an und fragte, ob ich die gesamte letzte Staffel drehen wolle, und ich konnte es erst kaum glauben. Für mich wurde ein großer Traum war, aber es war auch eine große Herausforderung und ich war fast zwei Jahre lang wie in einem Tunnel. Aber das war die einzige Möglichkeit, so in die Tiefe zu gehen."
Die komplette Box zur Serie gibt es ab sofort bei ARTHAUS. © Arthaus / Studiocanal
Bispuri habe dabei vor allem das einfangen wollen, was sie "die Ferrante-Atmosphäre" nennt. Die eben immer dann entsteht, wenn die vielschichtigen Charaktere im direkten Austausch sind. "Es ist keine Action-Serie", sagt Bispuri. "Mein Stil ist sehr einfach, ich mache gerne lange Einstellungen. Ich mag es nicht, die Schauspieler zu unterbrechen. Ich möchte eine physische Beziehung zwischen der Kamera und den Schauspielerinnen."
Diese – mit dezentem Understatement vorgetragene – Regie-Taktik beschert der Serie ein intensives Finale, das tatsächlich an die Emotionalität des Buches heranreicht. Vor allem das letzte bewusste Zusammentreffen von Lenù und Lila brennt sich regelrecht in die Erinnerung ein. "Ich bin so froh, dass wir Freundinnen waren", sagt Lila beim letzten Gespräch der beiden vor ihrem Verschwinden. Dann macht sie eine kurze Pause und ergänzt: "Und es immer noch sind."
Ein Satz, den wohl alle Ferrante-Fieber-Infizierten so unterschreiben würden: Auch wenn die Serie nun zu seinem Ende gefunden hat und die Veröffentlichung des letzten Bandes schon ein paar Jahre zurückliegt: Lenù und Lila werden uns nie mehr verlassen. Alle paar Jahre wird man die vier Romane und die Serienbox von Meine geniale Freundin aus dem Regal holen und noch einmal mit den beiden lieben, leiden, kämpfen und streiten. Und wann kommt eigentlich ein neuer Roman von ihr? Der letzte, "Das lügenhafte Leben der Erwachsene", liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück …
Daniel Koch