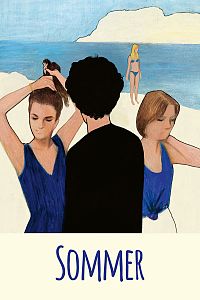Die Linie 1 fährt wieder! - Eine Hymne auf diese Lieder und Charaktere, die noch immer durch Berlin ziehen
Die Filmversion des vielleicht besten Berlin-Musicals erscheint am 25. August frisch poliert und in 4K restauriert. Die restaurierte Fassung feiert am kommenden Sonntag in Anwesenheit des Filmteams im arte Sommerkino Schloss Charlottenburg in Berlin Premiere.
"Ick hab kene Omma, die't jut mit mir meint / Kene Ratte, ken Hund, ken Freund / Mene Zukunft is en ewiger, endloser Schacht, / voll Glibber und Modder und schwarz wie die Nacht. / Wie gut, dass mir manchmal son Engel erscheint / Wie du – und für mich weint." Am vergangenen Donnerstag konnte man mich auf einem Reitplatz am Niederrhein auf einem Musikfestival sehen, wie ich diese Zeilen glücklich und leicht angetrunken in die Nacht schmetterte. Auf der Bühen standen die Beatsteaks, und Gitarrist Peter Baumann sang "Hey du" aus "Linie 1". Ein Lied, dass die Berliner Band schon seit Jahren immer mal wieder im Programm hat. Trotzdem fragte mich eine gute Freundin: "Was war denn da mit dir los, dass du da so mitgehst?"
Der Grund war der folgende: Ich habe in den letzten Wochen dieses Musical aus dem Jahre 1986 und die Verfilmung des Stammheim-Regisseurs Reinhard Hauff neu entdeckt und lieben gelernt. Ich schrieb nämlich den Essay für das Booklet der restaurierten Version, die am 25. August erscheinen wird. Eine Woche lang grub ich mich ein in die Lieder, die Historie, in Interviews mit den Machern, die Produktionsgeschichte. Ich sah den Film mehrere Male, hatte die Songs in meinen Spotify-Playlisten, summte manchmal in der U8 "Du sitzt mir gegenüber" oder eben "Du bist so schön, auch wenn Du weinst (Hey du)".
Nach und nach merkte ich dann, immer wieder, wenn ich in der Berliner U-Bahn saß: Sie sind alle noch da. Erich. Leichi. Die Bauarbeiter mit der Molle im Anschlag. Die Wilmersdorfer Witwen. Risi und Bisi, die sicher in Mitte leben und in einer Agentur jobben. Der nicht wirklich blinde Sänger. Boulettentrude, die heute veganen Döner verkaufen würde. Die Rocknudel, die jetzt wohl eher Rap Queen wäre. Der "Drogenberater" Bambi. Kriemhild. Der wehleidige, pseudo-sweete Anmacher-Hipster, den man heute einen "Pick-Me-Boy" nennen würde. Das stille türkische Ehepaar. Die Mafiosi. Der Zuhälter. Die Kontrolletti. Die Punks um Lumpi und Co. Die gefährlichen Typen. Die graue Pantherin, die den Spießern die Meinung bläst. Das rassistische Wutbürger-Paar. Der versoffene Schlucki und der weise Hermann. Die heißen Feger, die mal Risi und Bisi heißen und heute vermutlich Josy und Nosie. Der zugezogene Rockstar, der sich für einen Hauptstädter hält. Die traurige Maria, die aussieht wie ein "Warzenschwein" und singt wie ein Engel. Und natürlich: Das schöne, naive Mädchen – das mit großen Augen und Träumen am Bahnhof ankommt und in Berlin all das findet, was sie nicht gesucht hat …
Wenn man sich intensiv mit der Musik, der Geschichte, der Verfilmung und der Entstehung des Musicals Linie 1 befasst, eine persönliche Verbindung zu Berlin hat und dann auch noch in die U1 steigt, findet man sich schnell in einer seltsamen Zwischenwelt wieder. Man ist noch in Berlin, man rattert über die Schienen, man riecht, man sieht, man fühlt die U-Bahn, es stinkt, es lärmt, es nervt und ätzt, aber trotzdem verschwimmen die Zeiten und Eindrücke, legt sich ein Nebel auf die Realität, schwappen die wilden Vorwende-80er in die nicht weniger wilden 2020er, wird all dieses laute, aufdringliche Berlin auf einmal zu einem schäbig-schönen Paradies – und fast glaubt man, ein zärtlich gesungenes "Hey du, hey du, hör mir mal zu …" durch die Gänge wehen zu hören. Zumindest so lange, bis jemand auf Höhe Görlitzer Bahnhof den Kopf durch die Tür steckt, wie es Dieter Hildebrandt im Film Linie 1 tut, und im Tonfall der Durchsagen fordert: "Verrückt bleiben, bitte!" Oder hatte man sich das gerade nur eingebildet? Vermutlich ja.
Das Mädchen zwischen Kleister und Bambi in Kreuzberg. © Arthaus / Studiocanal
Deshalb freue ich mich sehr, dass diese gelungene Verfilmung, die einen Großteil des Original Casts aus dem GRIPS Theater an Bord hatte, nun noch einmal frisch aufpoliert auf die Schienen, die Leinwand und die Heimkions geschickt wird.
Am Sonntag wird Linie 1 in Anwesenheit des Filmteams im arte Sommerkino Schloss Charlottenburg (Beginn: 20:45 Uhr) gezeigt, ab nächster Woche gibt es ihn dann als VoD, DVD und Blu-ray. Schauen Sie sich diesen Film unbedingt noch einmal an – und setzen Sie sich, wenn möglich, danach in eine Berliner U-Bahn. Und vielleicht singt dann ja auch plötzlich jemand nicht "Hit The Road, Jack" – wie sonst immer – sondern ein zärtliches, tröstiches "Hey du" …
Daniel Koch